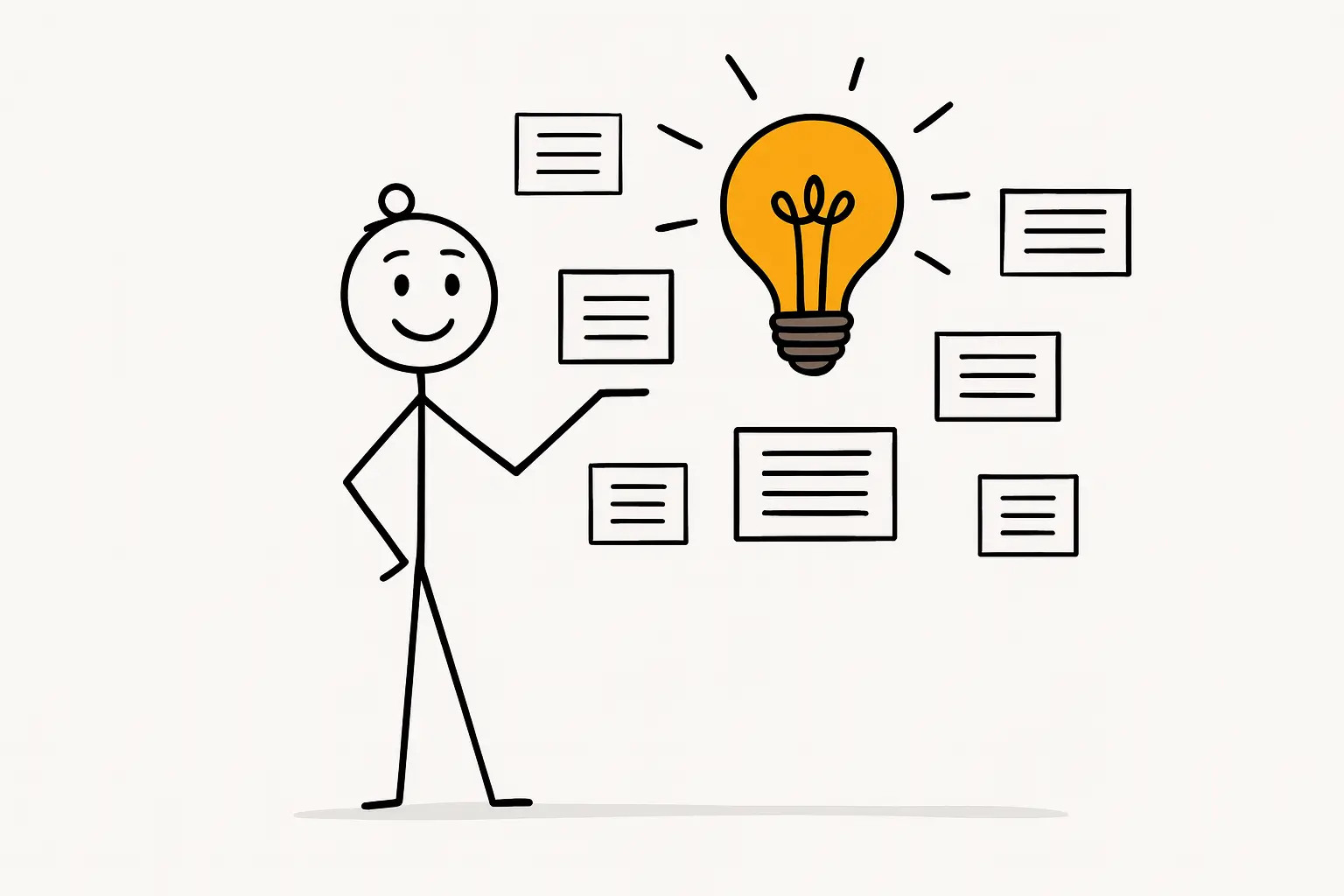
ACE-Hemmer sind Medikamente zur Behandlung von Bluthochdruck und Herzschwäche. Sie greifen in ein zentrales Regulationssystem des Körpers ein und senken so den Blutdruck. Eine häufige Nebenwirkung ist ein trockener Reizhusten.
- Was sind ACE-Hemmer?
- Wie wirken ACE-Hemmer im Körper?
- Wann werden ACE-Hemmer eingesetzt?
- Wie lange dauert es, bis ACE-Hemmer wirken?
- Was muss man bei der Einnahme beachten?
- Welche Nebenwirkungen sind möglich?
- Was ist der Unterschied zu Sartanen?
- Welche Rolle spielen ACE-Hemmer bei Husten?
- Quellen
Was sind ACE-Hemmer?
ACE-Hemmer (Angiotensin-Converting-Enzyme-Hemmer) sind Arzneimittel, die die Aktivität eines bestimmten Enzyms hemmen, das für die Bildung des gefäßverengenden Hormons Angiotensin II verantwortlich ist. Durch diese Hemmung bleibt die Gefäßspannung geringer – der Blutdruck sinkt.
Wie wirken ACE-Hemmer im Körper?
Sie blockieren das Enzym, das Angiotensin I in Angiotensin II umwandelt. Angiotensin II bewirkt normalerweise eine Verengung der Blutgefäße und erhöht den Blutdruck. Wird die Umwandlung verhindert, entspannen sich die Gefäße – der Blutdruck sinkt. Gleichzeitig wird die Wasserausscheidung über die Nieren gefördert, was das Herz entlastet.
Wann werden ACE-Hemmer eingesetzt?
Sie kommen vor allem bei folgenden Erkrankungen zum Einsatz:
- Bluthochdruck (Hypertonie)
- Herzschwäche (Herzinsuffizienz)
- Nach Herzinfarkten zur Herzunterstützung
- Bei bestimmten Nierenerkrankungen, z. B. diabetischer Nephropathie
Wie lange dauert es, bis ACE-Hemmer wirken?
Die blutdrucksenkende Wirkung setzt meist wenige Stunden nach der ersten Einnahme ein. Die volle Wirkung entwickelt sich oft innerhalb von ein bis zwei Wochen. Wichtig ist eine regelmäßige Einnahme, um einen stabilen Blutdruck zu erreichen.
Was muss man bei der Einnahme beachten?
- Blutdrucksenker sollten möglichst täglich zur gleichen Zeit eingenommen werden.
- Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist wichtig.
- Kaliumreiche Lebensmittel (z. B. Bananen, Nüsse) sollten nur in Maßen gegessen werden, da ACE-Hemmer den Kaliumspiegel erhöhen können.
- Bei Auftreten von Husten, Schwellungen oder Schwindel sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.
Welche Nebenwirkungen sind möglich?
Typische Nebenwirkungen betreffen vor allem die Atemwege und den Elektrolythaushalt. Hier einige Beispiele:
- Trockener Reizhusten (häufig, bis zu 20 % der Patienten)
- Erhöhter Kaliumspiegel im Blut (Hyperkaliämie)
- Niedriger Blutdruck (v. a. zu Beginn der Behandlung)
- Schwindel oder Kopfschmerzen
- Hautausschläge, selten Angioödeme (Schwellungen im Gesicht oder Halsbereich)
Was ist der Unterschied zu Sartanen?
Sartane (AT1-Rezeptorblocker) wirken ähnlich blutdrucksenkend, greifen aber an einer anderen Stelle im Renin-Angiotensin-System ein: Sie blockieren direkt die Wirkung von Angiotensin II an den Rezeptoren. Dadurch verursachen sie seltener Husten und gelten bei ACE-Hemmer-Unverträglichkeit als Alternative.
Welche Rolle spielen ACE-Hemmer bei Husten?
Der Husten entsteht durch die Anreicherung von Bradykinin, einem Botenstoff, der normalerweise vom ACE-Enzym abgebaut wird. Da dieses Enzym durch die Medikamente gehemmt wird, steigt der Bradykinin-Spiegel – was die Schleimhäute reizt und den typischen trockenen Reizhusten verursacht. Wenn der Husten belastend ist, kann ein Wechsel auf ein Sartan in Betracht gezogen werden.
Husten als Nebenwirkung von Medikamenten
Quellen
Aktories K, Forth W, Flockerzi V, Förstermann U, Hofmann F (Hrsg.). Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie. 13. Auflage. München: Elsevier; 2022. XXVIII, 1236 Seiten: Illustrationen; 28 cm. ISBN: 978-3-437-42622-3.
Karow T. Allgemeine und Spezielle Pharmakologie und Toxikologie 2024/25. Neuauflage 2023. Köln: Verlag Thomas Karow; 2023. 1414 Seiten. Enthält 2 Online-Ressourcen. ISBN: 978-3-9821223-4-2.
Seifert R. Basiswissen Pharmakologie. 2., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Berlin: Springer; 2021. XXVII, 584 Seiten: Illustrationen; 24 cm. ISBN: 978-3-662-60503-5.
Dieser Text dient ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzt keine ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung. Medizinisches Wissen verändert sich stetig – beachten Sie daher das Datum der Veröffentlichung. Bei gesundheitlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.
