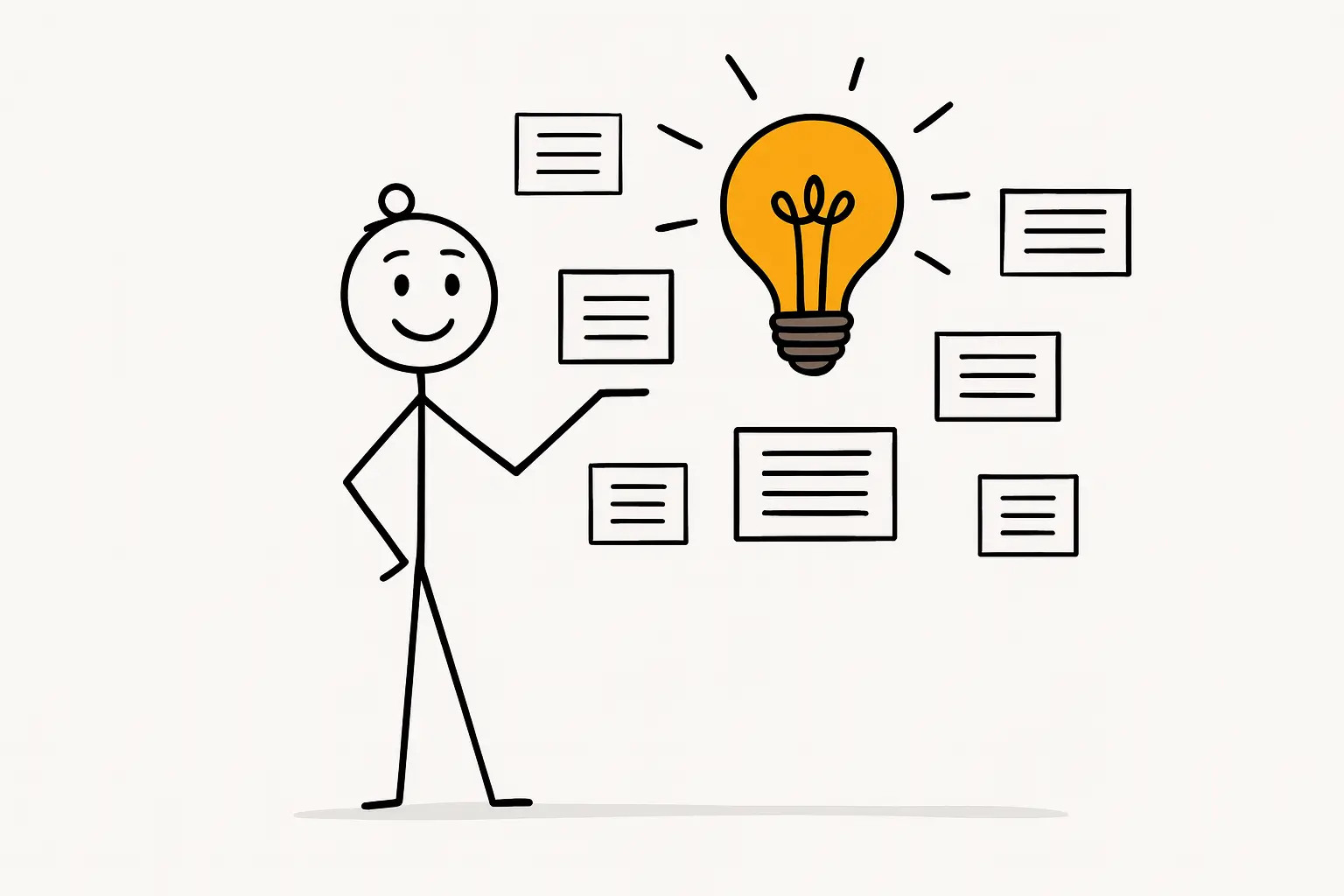
Reizhusten ist ein trockener, meist quälender Husten ohne Auswurf, der durch eine Überempfindlichkeit der Atemwege ausgelöst wird. Er kann akut nach Infekten auftreten oder chronisch werden – mit vielfältigen Ursachen und teils unklarer Herkunft.
- Was ist Reizhusten genau?
- Wie entsteht Reizhusten?
- Welche Ursachen kommen infrage?
- Wann spricht man von chronischem Reizhusten?
- Welche Warnzeichen sind ernst zu nehmen?
- Wie wird Reizhusten diagnostiziert?
- Wie wird Reizhusten behandelt?
- Welche Rolle spielen ACE-Hemmer bei Reizhusten?
- Was ist der Unterschied zu produktivem Husten?
- Quellen
Was ist Reizhusten genau?
Reizhusten ist eine Form des Hustens, bei der kein Schleim abgehustet wird. Mediziner:innen sprechen von trockenem oder unproduktivem Husten. Im Unterschied zum produktiven Husten fehlt beim Reizhusten das Sputum, also Auswurf aus den Bronchien. Der Hustenreflex wird dennoch ausgelöst, häufig durch mechanische oder chemische Reize.
Wie entsteht Reizhusten?
Ausgelöst wird Reizhusten durch eine Reizung der sensiblen Hustenrezeptoren in den Atemwegen. Diese senden über den Vagusnerv Signale an das Gehirn, das daraufhin den Hustenreflex aktiviert. Die Auslöser sind oft harmlos, wie trockene Luft, Staub, Rauch oder Temperaturwechsel, können aber auch auf Erkrankungen wie Asthma oder Reflux hindeuten. Frauen haben generell eine höhere Empfindlichkeit des Hustenreflexes.
Welche Ursachen kommen infrage?
Die Liste möglicher Auslöser ist lang. Zu den häufigsten Ursachen zählen:
- Atemwegsinfekte (z. B. nach einer Erkältung oder COVID-19)
- Chronische Erkrankungen wie Asthma bronchiale oder nicht-allergische eosinophile Bronchitis
- Magensäure-Reflux (gastroösophageale Refluxkrankheit, GERD)
- Nebenwirkungen von Medikamenten, insbesondere ACE-Hemmern
- Rauch- oder Staubinhalation (reaktive Atemwegserkrankung)
- Chronisch ungeklärter oder therapieresistenter Husten (UCC/RCC)
Reizhusten kann auch psychische Ursachen haben oder im Rahmen funktioneller Störungen auftreten (z. B. laryngeale Hypersensitivität).
Wann spricht man von chronischem Reizhusten?
Ein Husten gilt als chronisch, wenn er länger als acht Wochen anhält. Besteht er ohne erkennbare Ursache oder spricht er nicht auf die Standardtherapie an, handelt es sich um ungeklärten oder refraktären chronischen Husten (UCC/RCC). Beide Formen betreffen häufiger Frauen im mittleren bis höheren Lebensalter.
Welche Warnzeichen sind ernst zu nehmen?
Folgende Symptome sollten ärztlich abgeklärt werden:
- Bluthusten (Hämoptysen)
- Atemnot
- Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust
- Schluckstörungen oder Heiserkeit
- Zunehmender Husten bei Raucher:innen über 55 Jahre
Wie wird Reizhusten diagnostiziert?
Die Diagnostik beginnt mit einer gründlichen Anamnese inklusive Medikamentenliste sowie einer körperlichen Untersuchung. Basisuntersuchungen umfassen:
- Röntgen der Lunge in zwei Ebenen
- Lungenfunktionsprüfung
Bei Verdacht auf spezielle Ursachen folgen weiterführende Tests, etwa:
- eine Messung des Stickstoffmonoxids in der Ausatemluft (FeNO) und ein Inhalationstest mit reizenden Substanzen, um eine überempfindliche Bronchialschleimhaut nachzuweisen (z. B. bei Asthma oder nicht-allergischer eosinophiler Bronchitis)
- eine Spiegelung von Speiseröhre und Magen sowie eine Messung des Säuregehalts, um festzustellen, ob Magensäure bis in den Rachen aufsteigt (z. B. bei Refluxkrankheit)
- HNO-Diagnostik (bei chronischer Nasennebenhöhlenentzündung)
- Allergiediagnostik (bei Verdacht auf allergischen Reizhusten)
Wie wird Reizhusten behandelt?
Die Behandlung richtet sich nach der Ursache. Mögliche Maßnahmen:
- Absetzen von ACE-Hemmern bei medikamentenbedingtem Husten
- Inhalative Kortikosteroide bei einer bestimmten Art von Entzündung, bei der sich viele spezielle weiße Blutkörperchen (Eosinophile) in der Bronchialschleimhaut ansammeln
- Hochdosierte Protonenpumpenhemmer (PPI) bei Reflux
- Atemphysiotherapie (z. B. Techniken zur Hustenvermeidung, Sekretmobilisation)
- Logopädie bei funktionellen Störungen
Bei Formen von Reizhusten, für die keine klare Ursache gefunden wird (UCC = ungeklärter chronischer Husten) oder die trotz Therapie bestehen bleiben (RCC = refraktärer chronischer Husten), können auch bestimmte Medikamente eingesetzt werden. Diese Medikamente, die das Nervensystem beeinflussen und dadurch den überempfindlichen Hustenreiz dämpfen können, sind z. B. Gabapentin oder niedrig dosiertes Morphin. Allerdings können sie nur off-label und unter strenger ärztlicher Kontrolle genutzt werden.
Welche Rolle spielen ACE-Hemmer bei Reizhusten?
ACE-Hemmer sind blutdrucksenkende Medikamente, die bei etwa 10 % der Frauen und 5 % der Männer trockenen Reizhusten auslösen können. Der Husten tritt oft verzögert auf, Tage bis Monate nach Einnahmebeginn. Bei Verdacht sollte ein Umstieg auf Sartane erwogen werden.
Was ist der Unterschied zu produktivem Husten?
Produktiver Husten geht mit Schleimbildung einher und tritt typischerweise bei chronischer Bronchitis oder COPD auf. Reizhusten ist dagegen trocken, oft anfallsartig und besonders störend bei Reizexposition, Sprechen oder nachts. Die Prognose ist meist günstiger, sofern keine schwere Grunderkrankung vorliegt.
Erfahren Sie mehr über verwandte Begriffe wie Husten, ACE-Hemmer, Sartane.
Husten als Nebenwirkung von Medikamenten
ACE-Hemmer: Blutdrucksenkende Medikamente mit typischer Nebenwirkung Reizhusten
Sartane: Blutdrucksenker ohne Husten als Nebenwirkung
Quellen
Chamberlain SA, Garrod R, Douiri A, Masefield S, Powell P, Bücher C, Pandyan A, Morice AH, Birring SS. The impact of chronic cough: a cross-sectional European survey. Lung. 2015 Jun;193(3):401-8.
Irwin RS, French CL, Chang AB, Altman KW; CHEST Expert Cough Panel*. Classification of Cough as a Symptom in Adults and Management Algorithms: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2018 Jan;153(1):196-209.
Kardos P et al. Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin zur Diagnostik und Therapie von erwachsenen Patienten mit Husten. Pneumologie. 2019;73:143–80
Shim JS, Song WJ, Morice AH. Drug-Induced Cough. Physiol Res. 2020 Mar 27;69(Suppl 1):S81-S92.
Dieser Text dient ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzt keine ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung. Medizinisches Wissen verändert sich stetig – beachten Sie daher das Datum der Veröffentlichung. Bei gesundheitlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.
